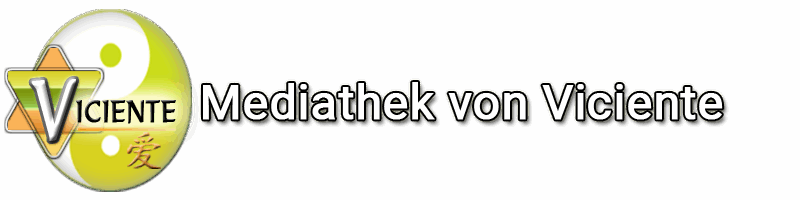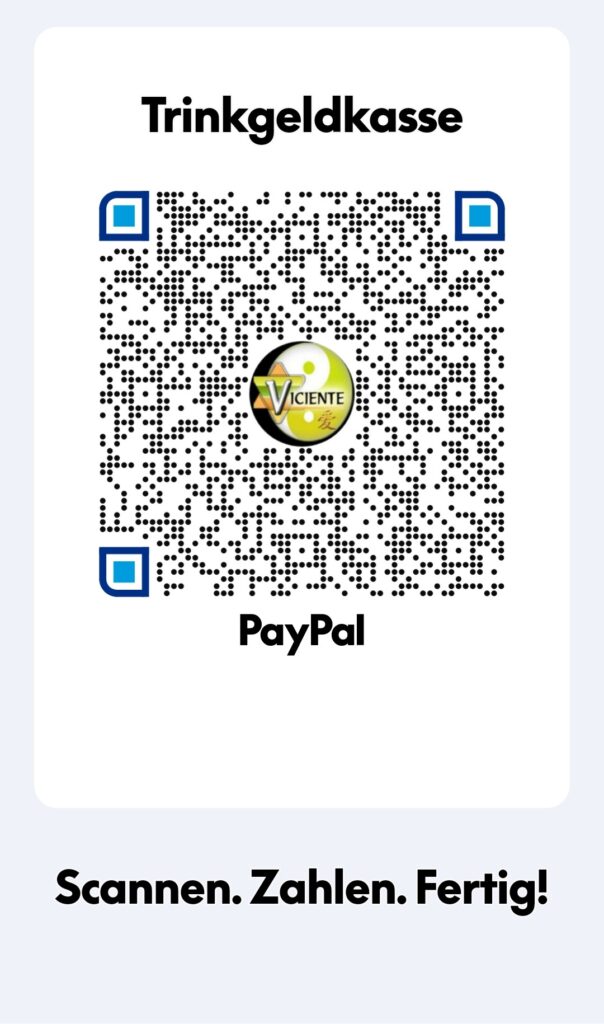Es gibt eine auffällige Häufung von Todesfällen unter AfD-Kandidaten vor der Kommunal-Wahl in Nordrhein-Westfalen. Wie wahrscheinlich ist es, dass dies ein zufälliges Ereignis ist? Im Video wird eine Abschätzung mittels Poisson-Verteilung vorgenommen und mit einer Monte-Carlo-Simulation überprüft.
Infos zu den Todesfällen: https://www.nzz.ch/international/sech…
►WEITERE INFORMATIONEN VON TEAM RIECK:
- Statistische Grundkonzepte & Fallstricke
Die initiale Fehlbewertung solcher Häufungen resultiert häufig aus fundamentalen statistischen Fehlschlüssen. Zentral ist das Multiples-Testing-Problem (Look-Elsewhere-Effekt). Die Ex-post Betrachtung eines spezifischen, seltenen Ereignisses ist irreführend. Die Wahrscheinlichkeit, irgendein ungewöhnliches Ereignis zu beobachten, ist stets höher als die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des ex ante spezifizierten Ereignisses. Analog: Die Wahrscheinlichkeit, ein beliebiges auffälliges Kfz-Kennzeichen zu sehen, ist hoch; die Wahrscheinlichkeit für ein exakt vorhergesagtes spezifisches Kennzeichen ist vernachlässigbar gering.
Für die Modellierung seltener Ereignisse in einer großen Population (n groß, p klein) ist die Poisson-Verteilung der Binomialverteilung vorzuziehen, da sie diese gut approximiert und mathematisch leichter handhabbar ist.
Ein Signifikanzniveau von u1% (z.B. 0,34%) bedeutet zwar statistische Seltenheit, ist jedoch nicht synonym mit Kausalität. Es ist eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für den Nachweis einer nicht-zufälligen Ursache. Weitere Untersuchung ist zwingend erforderlich.
- Ereignisdefinition & Datenbasis
Das zentrale Problem liegt in der präzisen Definition des Target-Ereignisses. Die berechnete Wahrscheinlichkeit variiert um Größenordnungen in Abhängigkeit von:
Der betrachteten Fallzahl (genau k vs. mindestens k Todesfälle).
Der definierten Population (nur Partei A vs. alle Kandidaten).
Dem betrachteten Zeitfenster (ein Monat vs. ein Jahr).
Die Datenqualität ist entscheidend. Jede seriöse Schätzung der erwarteten Todesfälle erfordert:
Alters- und geschlechtsspezifische Sterbewahrscheinlichkeiten (amtliche Sterbetafeln).
Die exakte Alters- und Geschlechterverteilung der betrachteten Kandidatengruppe.
Den exakten Untersuchungszeitraum.
Fehlen diese Daten, bleiben alle Berechnungen spekulativ.
- Kontext & Vergleiche
Eine isolierte Betrachtung ist wertlos. Erforderlich ist ein vergleichender Ansatz:
Altersstruktur: Eine Partei mit systematisch älteren Kandidaten weist eine höhere Basissterbewahrscheinlichkeit auf. Dies ist ein konfundierender (störender) Faktor, für den adjustiert werden muss.
Relative Häufigkeit: Todesfälle müssen mit denen anderer Parteien im gleichen Zeitraum verglichen werden. Eine isolierte Häufung in einer Gruppe ist auffällig; eine generelle Erhöhung über alle deutet auf einen gemeinsamen externen Faktor (z.B. Wahlkampfstress) hin.
Historische Vergleichsdaten: Gab es ähnliche Häufungen in der Vergangenheit? Dies hilft, die Baseline für zufällige Schwankungen zu kalibrieren.
- Alternative Erklärungsansätze
Ökonomen betrachten stets alternative Erklärungen jenseits der naheliegenden Kausalität (Zufall vs. Absicht):
Clusteing-Effekte: Zufällige räumliche oder zeitliche Häufungen sind ein bekanntes statistisches Phänomen und beweisen per se keine Kausalität.
Medienecho & Wahrnehmungsverzerrung: Initiale mediale Aufmerksamkeit führt zu einer verstärkten Wahrnehmung und Meldung nachfolgender, sonst vielleicht nicht beachteter Fälle. Dies erzeugt einen selbsterfüllenden Berichterstattungszyklus, der eine Häufung suggeriert.
- Handlungsempfehlungen für eine seriöse Untersuchung
Ein standardisierter, transparenter Prozess ist essentiell:
Versicherungsmathematisches Gutachten: Beauftragung eines Aktuars zur Berechnung der erwarteten Todesfallzahl unter Berücksichtigung aller demografischen und zeitlichen Parameter.
Forensische Standarduntersuchung: Bei unklaren Todesfällen sind Obduktionen der methodische Goldstandard zur Unterscheidung natürlicher von nicht-natürlichen Todesursachen.
Transparente Entscheidungsregeln: Staatsanwaltschaften müssen klare, statistisch fundierte Schwellenwerte definieren, ab wann eine rein zufällige Erklärung unwahrscheinlich genug ist, um Ermittlungen einzuleiten.
- Kognitive Verzerrungen (Biases)
Die öffentliche Debatte wird maßgeblich von kognitiven Verzerrungen getrieben:
Confirmation Bias: Die Interpretation von Daten wird unbewusst so vorgenommen, dass sie die bestehende weltanschauliche Überzeugung stützt.
Ankerheuristik: Der erste, oft dramatisierte und falsche Wahrscheinlichkeitswert dient als mentaler Anker, von dem sich eine rationale Diskussion nur schwer lösen kann.
Gegenmittel: Systematisches Gedankenexperiment.
… weitere Informationen auf YouTube >>
QUELLENHINWEIS: Prof. Dr. Christian Rieck 525.000 Abonnenten
Der Beitrag verfällt am 08.01.26 05:09.