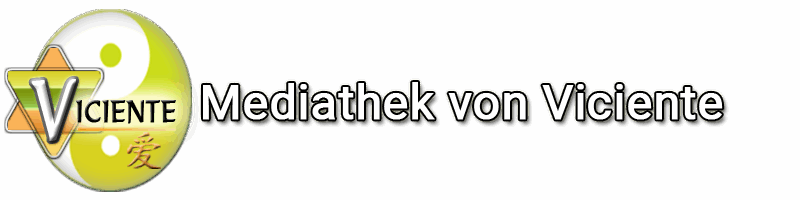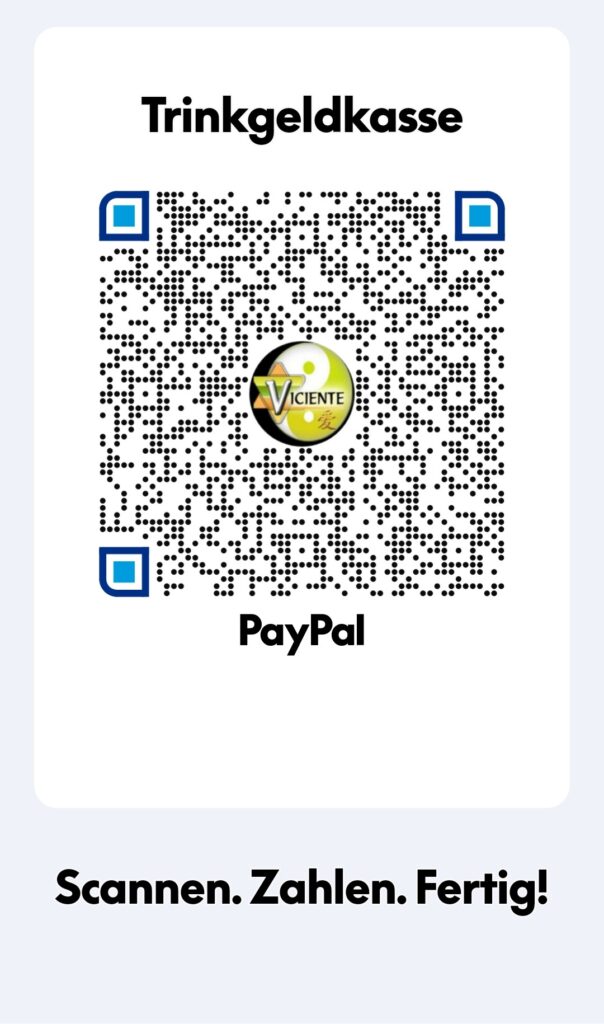Was ist mit der deutschen Autoindustrie passiert? Sie wollte rechts überholen und landet auf dem Standstreifen.
Das erwähnte Buch von Clayton Christensen:
The Innovator’s Dilemma – Warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren:
https://www.amazon.de/exec/obidos/ASI…
►WEITERE INFORMATIONEN VON TEAM RIECK:
- Das Scheitern von VW in der Elektromobilität: Drei fatale Fehlkalkulationen
a) Das Cashflow-Dilemma des „Technologiesprungs“
Volkswagens Strategie, den Verbrennungsmotor zugunsten der Elektromobilität abrupt zu vernachlässigen, folgte einer klassischen Fehleinschätzung disruptiver Übergänge. Nach Christensen können etablierte Unternehmen nur dann erfolgreich disruptiv agieren, wenn sie parallel beide Technologiepfade bedienen – andernfalls kollabiert die Profitabilität der „Cash Cow“. VW ignorierte diese Regel: Durch die vorzeitige Degradierung des Verbrenners büßte es Marktanteile ein, ohne dass die E-Modelle in Reichweite, Ladeinfrastruktur oder Preis-Leistung überzeugen konnten. Resultat: Ein doppelter Verlust – traditionelle Kunden wanderten ab, während die Elektroangebote gegen überlegene Konkurrenz chancenlos blieben.
b) Die China-Herausforderung: Strukturelle Unterlegenheit
Während VW noch mit Softwareproblemen und hohen Batteriekosten kämpfte, nutzten chinesische Hersteller wie BYD oder NIO ihre Heimatvorteile:
Skaleneffekte: Durch staatlich subventionierte Batterieproduktion und lokale Lieferketten sind chinesische E-Autos bis zu 30% günstiger.
Technologieführerschaft: Features wie „Battery Swapping“ (NIO) oder integrierte Fahrassistenzsysteme setzten neue Standards.
VWs Versuch, mit Joint Ventures (z. B. SAIC) Fuß zu fassen, scheiterte an mangelnder Agilität – ein typisches Problem westlicher Konzerne in China.
c) Die „Verbrannte Erde“-Strategie: Ein politischer Eigentor
Indem VW frühzeitig Verbrennerverbote befürwortete (Stichwort: EU-2035-Aus), untergrub es bewusst das eigene Kerngeschäft – in der Hoffnung, Wettbewerber zu destabilisieren. Doch dieser Schachzug beruhte auf zwei Trugschlüssen:
Regulatorische Naivität: Die Annahme, politische Vorgaben würden automatisch zu technologischer Führung führen, ignorierte globale Machtverschiebungen (China, eigene Standards).
Innovationsmythos: VW unterschätzte, dass disruptive Märkte (E-Mobilität) von Newcomern dominiert werden – nicht von etablierten Playern mit starren Strukturen.
- Das Kleinwagen-Dilemma: Wie regulatorische und kartellartige Mechanismen den Markt verzerren
a) Die EU als unintendierter Verbündeter Chinas
Europäische Regulierung (Euro 7, NCAP-Sicherheitsvors.) trieb die Kosten für Kleinwagen in die Höhe, während E-Autos durch die fiktive „Null-Emissions“-Zurechnung begünstigt wurden. Dies schuf eine paradoxe Situation:
Ökonomische Absurdität: Ein VW e-Up! wird als „emissionsfrei“ bilanziert – obwohl seine CO₂-Bilanz in der Gesamtlebenszyklusanalyse oft schlechter ist als die eines Toyota Hybrid.
Marktverzerrung: Hersteller priorisierten teure E-SUVs, um Flottenwerte zu optimieren – nicht um Kundenbedürfnisse zu bedienen.
b) Kartellartiges Verhalten: Kollektives Versagen
Die europäische Autoindustrie agierte de facto wie ein Oligopol: Durch gleichzeitiges Streichen von Modellen wie dem Ford Fiesta oder VW Up! entstand eine Angebotslücke. Diese implizite Koordination („Tacit Collusion“) funktionierte jedoch nur, solange kein externer Wettbewerber die Lücke füllte. Mit dem Einstieg chinesischer Hersteller (MG, BYD Dolphin) brach das System zusammen – ein Lehrstück über die Fragilität protektionistischer Märkte.
c) Der Smart-Fall: Symbol einer verfehlten Produktpolitik
Die Transformation des Smart von einem urbanen Kleinwagen zum Elektro-SUV illustriert das Grundproblem: Statt echter Innovation wurde ein „Compliance-Produkt“ geschaffen. Der Smart #1 (gebaut vom chinesischen Geely-Konzern) dient primär der Flottenbereinigung – doch ohne Preisvorteil oder Markenidentität blieb er ein Ladenhüter.
- Chinas Dominanz: Drei Säulen der Überlegenheit
a) Batterien: Der Schlüssel zur Wertschöpfungskette
China kontrolliert nicht nur 80% der globalen Batterieproduktion (CATL, BYD), sondern auch kritische Rohstoffe (Lithium, Kobalt).
b) Staat versus Markt: Das Subventionsparadoxon
Während die EU mit CO₂-Grenzwerten reguliert, setzt China auf direkte Subventionen:
Lokale Käuferprämien von bis zu 10.000 € pro E-Auto.
Kostenlose Ladeinfrastruktur in Metropolen.
Resultat: BYD kann Kompaktwagen wie den Dolphin für unter 20.000 € anbieten – europäische Hersteller scheitern bereits bei der Kostendeckung.
c) Ökosystem-Strategie: Vernetzung als Wettbewerbsvorteil
Chinesische Hersteller denken Mobilität ganzheitlich:
BYD produziert eigene Chips und Solaranlagen.
NIO integriert Batteriemietmodelle mit Cloud-Diensten.
Europa dagegen bleibt im Silodenken verhaftet – ein struktureller Nachteil.
QUELLENHINWEIS: Prof. Dr. Christian Rieck 522.000 Abonnenten
Der Beitrag verfällt am 13.12.25 05:18.